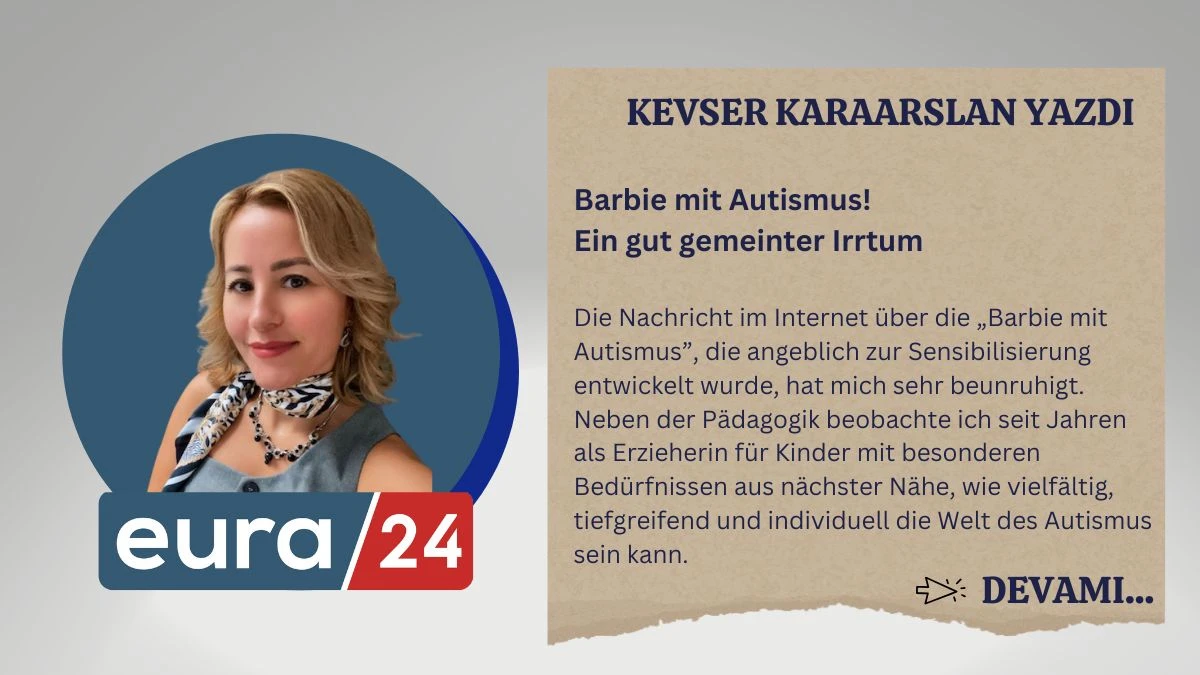
Die Nachricht im Internet über die „Barbie mit Autismus”, die angeblich zur Sensibilisierung entwickelt wurde, hat mich sehr beunruhigt. Neben der Pädagogik beobachte ich seit Jahren als Erzieherin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen aus nächster Nähe, wie vielfältig, tiefgreifend und individuell die Welt des Autismus sein kann. Ich bilde mich kontinuierlich in den Bereichen des Autismus und weiteren Entwicklungsfeldern fort. Genau deshalb empfinde ich die Werbesprache und die Darstellung dieser Puppe sowohl aus pädagogischer als auch aus menschlicher Sicht als sehr unzureichend, stellenweise auch schädlich.
Als ich die Nachricht über die geplante Produktion der autistischen Barbie zum ersten Mal hörte, dachte ich sofort an Folgendes: Die Autismus-Spektrum-Störung ist eine Diagnose, die selbst mit neurologischen Untersuchungen und verschiedenen Tests nur durch langwierige, wiederholte Beobachtungen eines Kindes eindeutig gestellt werden kann. Wie kann sie dann durch ein äußeres Erscheinungsbild repräsentiert werden? Diese Frage ist mehr als nur ein beruflicher Reflex, sie ist ein menschlicher Einspruch. Denn Autismus ist kein Zustand, den man „auf den ersten Blick“ erkennen kann.
In den Medien wird berichtet, dass diese neue Barbie mit Zubehör wie einem Fidget Spinner, geräuschunterdrückenden Kopfhörern, einem seitlich gerichteten Blick und einem AAC-Tablet ausgestattet ist, die bestimmte Merkmale autistischer Menschen symbolisieren sollen. Doch dabei wird eine grundlegende Tatsache übersehen: Autismus ist weder ein einheitliches Verhaltensmuster noch ein einheitliches Set an Bedürfnissen oder ein bestimmtes Erscheinungsbild. Genau das beschreibt der Begriff „Spektrum".
Bei manchen Kindern kann es zu Verzögerungen in der verbalen Kommunikation kommen, bei anderen zu Hyperaktivität; manche sind still und introvertiert, während andere sehr gesprächig sein können, aber Schwierigkeiten haben, soziale Hinweise zu verstehen. Selbst die Frage des Blickkontakts ist so unterschiedlich. Ich habe viele Schüler mit einer Autismusdiagnose erlebt, die mir direkt in die Augen, sogar in die Pupillen, schauen konnten, jedoch in ihrer kognitiven Verarbeitung und Wahrnehmungsgeschwindigkeit hinter ihren Gleichaltrigen lagen.
Daher ist es nicht wissenschaftlich, die Augen eines Babys so zu gestalten, dass sie zur Seite schauen und dies als „Vermeidung von Augenkontakt bei Menschen mit Autismus” darzustellen. Das ist eine vereinfachende und reduktionistische Herangehensweise.
Die Diagnose von Autismus wird nicht anhand bestimmter Objekte, sondern anhand von Verhaltensmustern und Entwicklungsprozessen gestellt. Dennoch präsentiert diese Barbie-Puppe Autismus so, als könne er anhand bestimmter Accessoires und äußerer Merkmale definiert werden. Pädagogisch gesehen ist dies eine sehr problematische Darstellungsweise. Denn sie vermittelt Kindern die Botschaft: „So sieht Autismus aus”. Dabei gibt es nicht nur eine einzige „Form von Autismus”.
Spielzeuge sind für Kinder nicht nur Unterhaltungsmittel, sondern auch wichtige Werkzeuge, mit denen sie die Welt, Menschen und Beziehungen begreifen. Die Botschaft, die durch ein Spielzeug vermittelt wird, hinterlässt in der kindlichen Psyche langfristige Spuren. Wenn ein Spielzeug Autismus nur durch eine Figur repräsentiert, die Kopfhörer trägt, mit bestimmten Gegenständen spielt oder immer auf eine bestimmte Weise schaut, ist das keine Inklusion, sondern eine abgeschwächte Form der Ausgrenzung. Anstatt Unterschiede zu verstehen, werden sie zu einem „unterscheidbaren Etikett”.
Ein weiterer irritierender Aspekt ist die besondere Hervorhebung, dass das Gesicht des Babys von den Gesichtszügen indischer Frauen inspiriert wurde. Selbstverständlich ist die Repräsentation unterschiedlicher ethnischer Hintergründe im Spielzeugdesign wichrig. Wenn diese Darstellung jedoch mit der Erklärung des Autismus in Verbindung gebracht wird, entsteht eine problematische Bedeutung. Bewusst oder unbewusst wird damit die Vorstellung vermittelt, dass es so etwas wie „das Gesicht des Autismus” gibt. Dies reduziert sowohl Autismus als auch ethnische Identitäten auf eine oberflächliche und symbolische Ebene.
Wenn man all dies zusammennimmt, überwiegt das Gefühl, dass diese Puppe weniger zur Sensibilisierung beiträgt, sondern vielmehr Teil einer Marketingstrategie ist. Es ist bekannt, dass die Marke Barbie versucht, ihre frühere Popularität durch Produktvielfalt aufrechtzuerhalten. Wenn diese Vielfalt jedoch auf Kosten der physischen und emotionalen Realität von Menschen mit besonderen Bedürfnissen erreicht wird, die zu einem Werbemittel umfunktioniert werden, das der Marke einen Mehrwert verleiht, muss man innehalten und nachdenken. Dies ist weniger Inklusion als vielmehr eine „wohlmeinend wirkende” Profitgier.
Aus diesem Grund ist der Verzicht auf den Kauf dieser Barbie nicht nur eine Konsumentscheidung. Es ist eine bewusste Haltung dazu, welche Botschaften wir Kindern vermitteln wollen. Echte Inklusion beginnt nicht mit Symbolen, Accessoires oder einzelnen Darstellungen, sondern mit der Akzeptanz individueller Unterschiede. Autismus hat Millionen von verschiedenen Gesichtern, Erfahrungen und Ausdrucksformen. Dies mit einer einzigen Puppe „vermitteln” zu wollen, ist pädagogisch unzureichend und emotional irreführend.
Es gibt einen besseren Weg; Kindern echte Lebensgeschichten erzählen, verschiedene Charaktere in ihrer Vielfalt präsentieren, Menschen mit Autismus Raum für ihre eigenen Stimmen und Erfahrungen geben... Nur so kann ein respektvoller und wirklich inklusiver Ansatz geschaffen werden.
Deshalb sage ich es warmherzig, aber klar: Diese Barbie nicht zu kaufen, ist eine äußerst berechtigte und sinnvolle Entscheidung, um Stereotypen, die Autismus vereinfachen, abzulehnen und im Umgang mit Kindern ein tieferes, zutreffenderes und menschlicheres Verständnis zu verteidigen.
Autismus hat kein Gesicht. Punkt.

